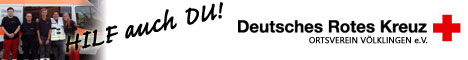St. Josef
1873:
Die Pfarrei St. Josef wird eigenständig. Bisher war sie Filiale des Bezirks Völklingen. Bereits in den Jahren zuvor lies man nichts unversucht, um eine eigene Kirche in den Ort zu bekommen, doch erst 1873 sollte es soweit sein: Die Witwe des ehemaligen Brückengeldhebers Georg Zacke aus Koblenz, eine geborene Katharina Dellstein aus Wehrden, kaufte ein kleines Häuschen um es in eine Kapelle umzugestallten. Im Herbst konnte diese bezogen und mit ihrer Glocke eingeweiht werden. (LXVII. S.17)
1894:
Ein Kirchenbauverein wird gegründet. (LXVII. S.17)
1897:
Die Pfarrgemeinde Völklingen wird mit dem Kirchenbau in Wehrden betraut. (LXVII. S.17)
1898:
Baubeginn an der heutigen Sankt Josef-Kirche. (LXVII. S.17)
1900:
Am 21. April wird Wehrden zur „Vikarie“ mit eigenen Kirchenbüchern. (LXVII. S.17)
1903:
Konsektierung der neuen Kirche. (LXVII. S.17)
1905:
Die Gemeinde erhält eine Orgel als Geschenk. Es wird vermutet, dass diese zuvor Teil eines größeren Instruments in der zerstörten Klosterkirche zu Himmerod (Wittlich) war – dies belegen Pergamentreste des Klosters, die das Innere der Luftkanäle abdichteten. Außerdem spricht die Existenz eines exakten Gegenstücks dieses Instruments in Schwarzrheindorf für diese Annahme. Die Entstehung des Instruments wird entsprechend für das 16. Jahrhundert geschätzt. Nach einer Zwischenstation im Dom von Trier kam das Instrument als Schenkung nach Wehrden, wo es nur noch in Teilen aufgebaut wurde. (LXVII. S.48)
1906:
Wehrden wird zur eigenständigen Pfarrei erhoben.(LXVII. S.17)
1917:
Drei Glocken mussten abgegeben werden. (LXVII. S.18)
1922:
Beschaffung neuer Glocken: Sie wurden wie auch die ersten bei der Glockenbaufirma Mabilon aus Saarburg gegossen. (LXVII. S.19)
1926:
Das Pfarrheim konnte bezogen werden. (LXVII. S.20)
1929-30:
Die Orgel wird gänzlich umgestaltet: Die Straßsburger Orgelbaufirma Röthinger erneuerte und erweiterte die Orgel, die nicht nur unter Kriegsschädigungen litt. (LXVII. S.48)
1932:
Eine Heizung wurde in die Kirche eingebaut. (LXVII. S.21)
1942:
Wieder mussten zwei Glocken der Kirche zu Kriegszwecken abgegeben werden, außerdem musste man Gegenstände der Kirche abgeben: Darunter eine wige Lampe, ein Gong und 25 Altarkerzenleuchter. (LXVII. S.22)
nach dem 2. Weltkrieg:
Die Kirche wurde während des Kriegs stakr beschädigt: Die Fenster wurden zerstört, das Dach und die darunter befindlichen Gewölbe stark beschädigt. Die Heizung war unbrauchbar und die Orgel stark in Mitleidenschaft gezogen. (LXVII. S.22) Die Orgel wurde nur provisorisch überholt. (LXVII. S.49)
nach 1947:
Instandsetzung der Kirche (LXVII. S.23)
1954:
Die vier neuen Glocken konnten zu Ostern erstmals leuten.
1962:
Am 19. September fasste der Stadtrat der Stadt Völklingen den Beschluss, der Gemeinde ein Baugrundstück für einen weiteren Kirchenbau auf dem Wehrdener Berg zu verkaufen. (LXVII. S.26)
1960er Jahre:
In dieser Zeit wurden Schmuckstücke aus dem Kirchenraum entfernt: Darunter die Heiligenfiguren, der Kreuzweg, die Kommunionbank und die Kanzel. (LXVII. S.27) Heute finden sich zumindest der Kreuzweg und die Heiligenfiguren wieder an ihrem einstigen Platz.
1964:
Der Grundstein für die Kirche St. Hedwig wurde gelegt. (LXVII. S.28)
1965:
Konsekration der Kirche Sankt Hedwig im Dezember. (LXVII. S.28)
1966:
Die Heusweiler Firma Mayer setzte die Orgel in Stand. (LXVII. S.49)
1972:
Die Kirche bekommt eine neue Heizung. (LXVII. S.32)
1975:
Sanierung des Außenputzes der Kirche (LXVII. S.32)
1982-1984:
Neubau des KIrchenaufganges. (LXVII. S.32)
1988:
Abschluss von Sanierungen im Inneren der Kirche, sie wurde um einen Altarraum erweitert und die wiedergefundenen Heiligenfiguren wurden wieder aufgestellt (LXVII. S.32)
1989:
Der Turm benötigt eine neue Spitze, der alte Hahn wurde versteigert und bekam so seine neue Heimat bei einem benachbarten Altenwohnheim. (LXVII. S.34)
1994/1995:
Eine neue Orgel wird gebaut, dabei wurden die Kreuzwegbilder hinter der Orgel wiedergefunden. Ein Gemeindemitglied restaurierte die Bilder, so konnten sie wieder angebracht werden. (LXVII. S.34/35) Die Orgel ist zwar neu, doch einige Teile wurden nochmal verwendet und stammen aus dem alten Instrument, so zum Beispiel einige Pfeifen. (LXVII. S.49)